Timothy Keller (1950–2023) war einer der bekanntesten evangelikalen Theologen der letzten Jahrzehnte. Millionen Menschen haben seine Bücher gelesen und seine Predigten gehört. In New York gründete er eine Gemeinde für zweifelnde Zeitgenossen, die schließlich mehrere tausend Besucher hatte. Zentral für seine Bücher ist, dass er Christus ins Zentrum stellt und gleichzeitig den Herausforderungen unserer säkularen Kultur begegnet. Im Buch wird besonders sein Weg dahin deutlich. Es geht also in erster Linie um seine „geistliche und intellektuelle Entwicklung“. Lebensstationen spielen dabei eine Rolle, werden aber weniger fokussiert.
Obwohl ich Kellers reformierte Positionen weitgehend nicht teile, habe ich fast alle Bücher, die von ihm auf Deutsch erschienen sind, mit Gewinn gelesen und vieles darin als sehr hilfreich erlebt. So sind auch über die Jahre einige Rezensionen seiner Bücher erschienen.[1]
Nun ist diese Biographie Kellers von Collin Hansen erschienen. Er schreibt: „Ich habe dieses Buch nicht als Klon von Keller geschrieben, aber mit viel persönlicher Wertschätzung und einer Beziehung, die bis ins Jahr 2007 zurückreicht … Ich bin kein enger Freund der Familie … Seit 2007 habe ich unzählige Male … mit Keller darüber gesprochen, was er liest und was er dabei lernt. Ich bin dankbar dafür, dass andere durch dieses Buch an diesen Gesprächen teilhaben und sich inspirieren lassen können.“
Das Buch ist in vier Hauptteile gegliedert: 1. Ehrlich gegenüber Gott (1950–1972), 2. Professoren und Kommilitonen (1972–1975), 3. Feuerprobe (1975–1989), 4. Von New York in die Welt (1989–2023). Es hat einen Bildteil, ein Personenregister und viele Fußnoten.
Die Lektüre setzt einiges an theologischem und auch geistesgeschichtlichem Wissen voraus. Sie reflektiert manche interessanten Positionen und macht auch das Entstehen einiger Bücher Kellers transparent. Die vielen Namen sind für den Leser öfter kaum einzuordnen, und es gibt auch Schwächen bei der Chronologie. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Biographie, die recht nüchtern geschrieben ist und nicht den Anspruch erhebt, Kellers Leben kritisch-distanziert zu betrachten. Man bekommt bei der Lektüre viele wertvolle Impulse und auch Leseideen. Somit kann sie empfohlen werden.[2]
Hier noch einige Zitate aus dem Buch, auch um einen Text- und Leseeindruck zu vermitteln:
Der dänische Philosoph und Lutheraner Søren Kierkegaard beschreibt Sünde als Aufbau seiner Identität auf etwas anderem als Gott.
Ernest Becker half Keller, diese Theologie in die heutige Zeit zu übersetzen … Becker [erklärt], dass die Amerikaner ihre Sinnsuche von Gott, Familie und Nation auf die romantische Liebe verlagert haben. Die Vergötterung der Liebesbeziehung führt allerdings zu den gleichen Problemen wie die Anbetung der Eltern oder der Flagge.
„Wir alle beten etwas an“, sagte Wallace … „Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein überzeugender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles Anbetungsobjekt auszusuchen, ist …, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird.“ Es wird nie genug Geld da sein. Unser Körper baut mit dem Alter ab. Macht korrumpiert und wir zerstören andere, um unsere Angst zu verbergen.
Der Soziologe Christian Smith beschriebt das post-aufklärerische Dilemma als ein spirituelles Projekt auf der Suche nach einem heiligen Gut: „Alles neu zu machen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, nicht an Traditionen gebunden zu sein, die größtmögliche Wahl zu haben, frei von allen Zwängen zu sein, sich alles leisten zu können, was man will, zu leben, wie man will – das ist die Leitvision des spirituellen Projekts der Moderne.“
Keller erklärt: „Dass wir unsere Identität eben nicht allein ‚von innen‘ beziehen. Wir filtern vielmehr unsere Gefühle und Impulse durch ein von außen kommendes moralisches Bewertungsraster, das uns hilft zu entscheiden, welche Gefühle zu meiner Identität gehören, sodass ich sie offen ausdrücken darf – und welche nicht. Es ist dieses moralische Raster oder ‚Sieb‘ und nicht meine nackten, unbearbeiteten Gefühle und Impulse, das meine Identität prägt und formt. Wir mögen noch so sehr das Gegenteil beteuern – tief innen wissen wir, dass das, was in den Tiefen unserer Seele liegt, nicht ausreicht, um uns Wegweisung für unser Leben zu geben. Wir brauchen irgendwelche Regeln und Normen von außen, die uns helfen, mit den widerstreitenden Impulsen in uns umzugehen. Und woher beziehen unsere angelsächsischen Krieger und unser junger Mann aus dem heutigen Manhattan ihre Beurteilungsraster? Aus ihren Kulturen, aus ihrer Gesellschaft und deren Werten, Prämissen und Mythen. Sie beschließen eben nicht, ‚sie selber‘ zu sein; sie filtern und sieben ihre Gefühle und werfen die einen weg, um die anderen zu behalten. Sie wählen dasjenige ‚Ich‘, das ihre Kultur ihnen als mögliche Option erlaubt. Eine Identität, die sich rein aus der Innenschau der persönlichen Gefühle und Wünsche speist, ist schlicht unmöglich.“
In moderner Sicht, so Taylor, existiert Gott dagegen nur noch zu unserem Nutzen. Eine Folge dieses Wandels ist, dass wir Leiden nicht mehr ertragen können, weil wir Gott nicht vertrauen können, wenn wir den Sinn von etwas nicht verstehen.
Keller: „Was Christen in Jesus finden:
Keller in seinem Buch über Jona: „Diese beiden modernen Glaubensartikel – dass wir uns alle für Gerechtigkeit und gleiche Rechte für alle einsetzen müssen, aber dass es keine von Gott kommende moralisch absoluten Werte gibt – setzen sich gegenseitig matt. In modernen säkularen Schulen erfährt jedes Kind, dass es sich selbst treu sein muss, dass es seine tiefsten Wünsche und Träume entdecken und verwirklichen muss und dass Verwandte, die Gesellschaft, die Tradition oder Religion kein Recht haben, ihm dabei im Weg zu stehen. Verwirkliche dich selbst, heißt die Parole. Und dann fordert man das Kind auf, für Gerechtigkeit, Versöhnung und Güte einzutreten, also für lauter Dinge, die mit Selbstverleugnung zu tun haben, dem genauen Gegenteil von Selbstverwirklichung. Die Gesellschaft lehrt den großen Relativismus und fordert anschließend dazu auf, uns ethisch zu verhalten. Sie ermutigt uns, uns selbst zu suchen, und ruft uns auf, uns selbst zu opfern.“
Jochen Klein
[1] Warum Gott, Der verschwenderische Gott und Es ist nicht alles Gott, was glänzt; Berufung; Gott im Leid begegnen in; Glauben wozu; Jona; Hoffnung in Zeiten der Angst. Auf www. Denkendglauben.de. Über den Tod wurde von Christoph Schäfer in Zeit & Schrift 3/2023, S. 33 rezensiert.
[2] Wer sich konkreter über den Inhalt informieren möchte, findet z.B. auf www.evangelium21.net zwei Zusammenfassungen des Buches.
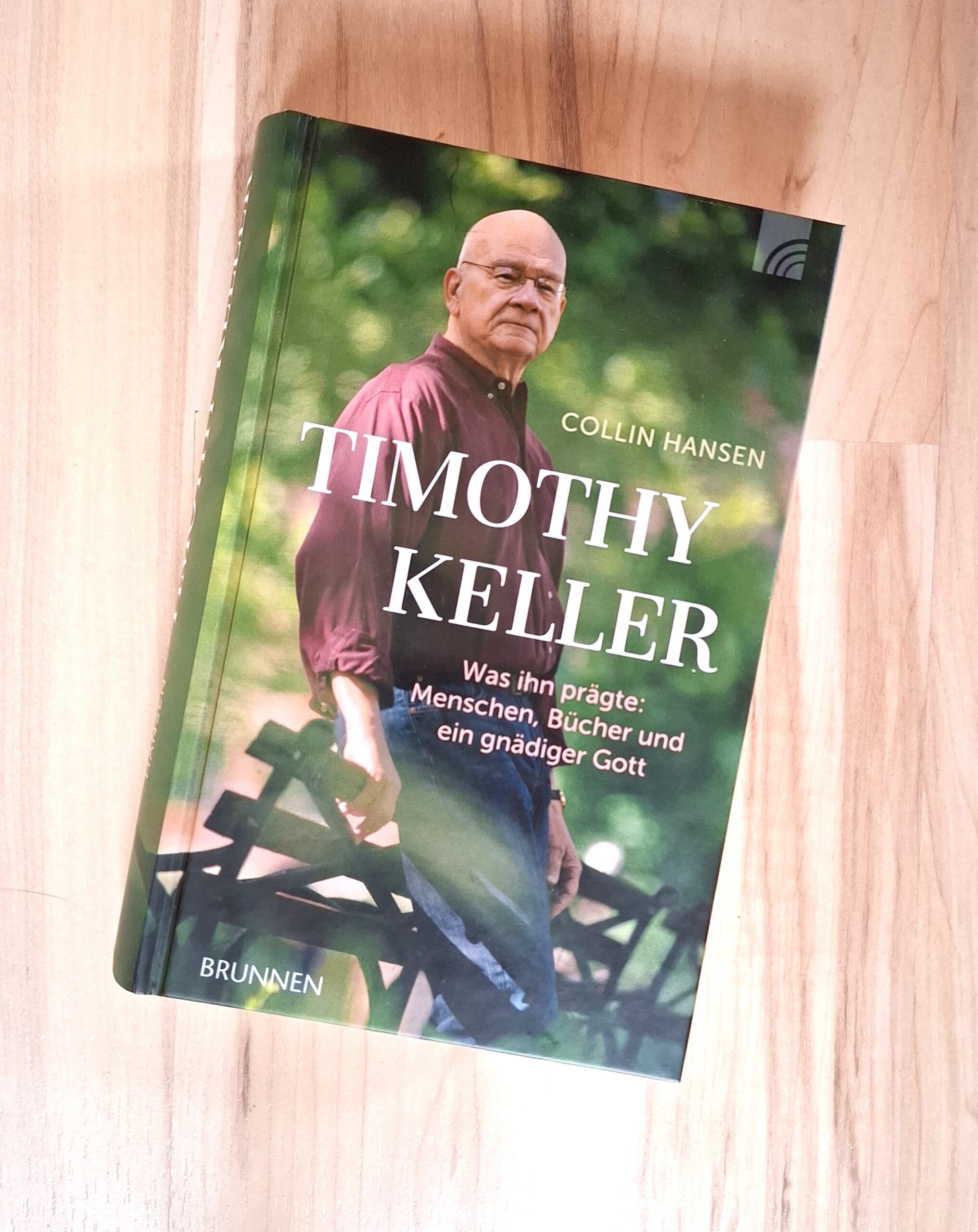
Impressum | Datenschutz
Copyright 2024 © Jochen Klein
Design & Programmierung: Ideegrafik Kreativagentur GmbH