In der Gesellschaft allgemein und so auch in Schule und Universität spielt die Bibel schon seit längerem nur noch eine geringe Rolle. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass durch die Bibelkritik insbesondere seit der Epoche der Aufklärung die Glaubwürdigkeit der Bibel zunehmend infrage gestellt und angegriffen worden ist. So ist es zu begrüßen, dass der pensionierte Religionslehrer Matthias Hilbert ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat.
Im ersten Teil widmet er sich der historisch-kritischen Theologie und weist deren Problematik, Unhaltbarkeit und Unwissenschaftlichkeit nach. Hilbert schreibt: „Bei der Beschäftigung mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit der Bibel und derjenigen der historisch-kritischen Theologie bzw. Exegese (Auslegung) ist mir schon früh aufgefallen, dass deren vermeintliche Ergebnisse allzu oft lediglich auf Prämissen und Spekulationen, auf Vorurteilen und Unterstellungen beruhen, nicht aber als Resultat unvoreingenommener historischer Untersuchungen gelten können“ (S. 7). Die Gesamtproblematik bringt auch der Heidelberger Theologe und Bibelwissenschaftler Klaus Berger in seinem Buch Die Bibelfälscher. Wie wir um die Wahrheit betrogen werden auf den Punkt. Hilbert zitiert ihn zustimmend: „Die historisch-kritische Exegese der letzten 200 Jahre hat alles Porzellan im Haus der Christenheit zerschlagen. Bis hin zur letzten Blumenvase. (…) Sie hat viele Theologiestudierende zum Abbruch ihres Studiums gebracht und lieferte vielen Menschen wohlfeile Argumente, um aus der Kirche auszutreten. Sie hat den Atheismus gefördert (…). Sie hat stets den kritischen Verstand befeuert und vermutlich niemanden zum Christentum bekehrt. (…) Wenn aber der Exeget bei seinem Tun selbst nicht weiß, wo er steht, dann dringen Ersatz-Weltanschauungen in das zarte Gewebe ein, an dem er arbeitet“ (S. 8). Ein Zitat von C. S. Lewis soll diese Argumentationslinie abschließen: „Sie behaupten, ihre Forschungen hätten zu dieser Lehre geführt. Aber in Wirklichkeit haben sie zuerst ihre Lehre aufgestellt und dann auf dieser Grundlage ihre Forschungen interpretiert“ (S. 9).
Nach diesen grundsätzlichen Erwägungen skizziert Hilbert kurz die Umkehr der Theologieprofessorin Eta Linnemann (1926–2009). Sie hatte sich 1970 in Marburg bei den bekannten Vertretern der historisch-kritischen Methode Rudolf Bultmann und Ernst Fuchs habilitiert. 1978 kam sie zum Glauben, verwarf ihre alten Einsichten und bekämpfte fortan diese Methode.[1]
Im Folgenden stellt Hilbert die grundlegenden Thesen der historisch-kritischen Methode vor und macht ihre zentralen Schwachstellen deutlich, gipfelnd in einem Zitat von Joseph Ratzinger: „Bibelauslegung kann in der Tat zum Instrument des Antichristen werden“ (S. 24).
Danach behandelt der Verfasser das Thema „Gotteswort oder Menschenwort“ und verdeutlicht dabei auch die historische Glaubwürdigkeit der biblischen Texte. Er fasst zusammen: „Was die Glaubwürdigkeit der in den neutestamentlichen Texten gemachten Angaben und Aussagen angeht, so sind die historisch-kritischen Theologen in ihrem grundsätzlichen, vorurteilsbeladenen Skeptizismus und ihrem Hang zur permanenten Problematisierung der biblischen Texte und zur Schaffung immer neuer Hypothesen oftmals kritischer als die ‚gelernten Historiker‘ selbst“ (S. 33). Er zitiert auch F. F. Bruce: „Wir haben viel mehr Unterlagen für die neutestamentlichen Schriften als für die meisten Schriften klassischer Autoren, deren Echtheit anzuzweifeln niemandem einfallen würde. Wäre das Neue Testament eine Sammlung von weltlichen Schriften, so wäre seine Echtheit im Allgemeinen über allen Zweifel erhaben. Es ist eine seltsame Tatsache, dass Historiker den neutestamentlichen Schriften oft viel bereitwilliger Vertrauen geschenkt haben als viele Theologen“ (S. 34). Die Göttinger Althistorikerin Helga Botermann ergänzt: „Seit Jahren bin ich schockiert über die Art, wie die Neutestamentler mit ihren Quellen umgehen. Sie haben es geschafft, alles so infrage zu stellen, dass sowohl der historische Jesus wie der historische Paulus kaum nach fassbar sind. Wenn die Althistoriker diese Maßstäbe übernähmen, könnten sie sich gleich verabschieden. Es gäbe nicht mehr viel zu bearbeiten“ (S. 34).
Im nächsten Kapitel legt der Autor hilfreiche Gedanken zum „rechten Umgang mit der Bibel“ dar, wobei aber folgende Formulierung befremdet und auch nicht gut in den sonstigen Tenor des Buches passt: „Die Hoffnung aber, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe dennoch einen Weg finden wird, auch die in der Hölle Verweilenden seines Heils eines Tages teilhaftig werden zu lassen, – diese Hoffnung brauchen wir deshalb nicht aufzugeben“ (S. 43f.).
Weitere Themen sind dann Geburt und Auferstehung Jesu. Diese insgesamt überzeugende Darlegung wird durch einzelne Aussagen über die Verfasser der Evangelien etwas getrübt, lassen sie sich doch nur schwer mit dem Prinzip der göttlichen Inspiration vereinbaren. Hilbert spricht allgemein von Erinnerungen an vergangene Ereignisse und schreibt dann: „Wie unterschiedlich der eine oder andere der Anwesenden die Details des Geschehnisses nach seiner Erinnerung wiedergibt und wie man sich dabei zum Teil gegenseitig korrigiert … das Kernereignis also … aber zweifelsfrei übereinstimmt und so die Beweiskraft erhält“ (S. 67). „Möglicherweise war es bei dem Überlieferungsprozess auch zu der einen oder anderen Ungenauigkeit und Abweichung oder bei den Verfassern auch zu eigenen Erinnerungsfehlern und ‑lücken im Detail gekommen“ (S. 67). – Da gibt es doch bessere Argumente in Bezug auf die Harmonisierung scheinbar widersprüchlicher Aspekte.
Der erste Teil schließt mit einer ausführlichen Erörterung der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu ab.
Im zweiten Teil behandelt der Autor das Thema „biblischer Realismus“ in Bezug auf Gott den Schöpfer, den Menschen und die Sünde, die Existenz des Bösen, das Volk Israel und die Zeichen der Endzeit. Diese Erörterungen sind hilfreich, da sie biblische Hauptlinien herausarbeiten und diese oft gegen den antibiblischen Mainstream abgrenzen. Sehr spezielle Erörterungen, z.B. über das geniale Verhalten der Bienen, können dabei auch überblättert werden. Der durchaus interessante Teil über die Geschichte des Volkes Israel ist ebenfalls recht ausführlich, hat Hilbert doch u.a. zum Ziel, den Antisemitismus in einen großen Zusammenhang zu stellen und zu erläutern, dass der Kampf gegen Israel letztlich eine Form des Widerstandes gegen Gott und Christus ist. Im letzten Teil spart der Autor dann auch nicht mit berechtigter Kritik an den Kirchen und zeigt nachvollziehbar, wie sie weitgehend zum Opfer des Zeitgeistes geworden und von der biblischen Lehre abgewichen sind. Hier wäre noch zu ergänzen, dass ihre unbiblischen Ideen mittlerweile auch zunehmend in evangelikale Bereiche eindringen.[2]
Alles in allem kommt dem Buch das Verdienst zu, wesentliche Themen rund um die Bibel und deren Botschaft transparent zu machen und von dieser her zu reflektieren. Es ist sehr gut recherchiert und mit vielen Nachweisen versehen. Nur nebenbei soll erwähnt werden, dass einige Personen, von denen zum Teil zustimmungswürdige Zitate abgedruckt werden, aus aufgezeigter biblischer Sicht weltanschaulich problematisch sind. Bei einigen Themen deutet der Autor Sichtweisen auch nur kurz an, ohne sie weiterzuführen (z.B. 24-Stunden-Tage am Anfang der Bibel). Das Sprachniveau ist angemessen akademisch-präzise, ohne künstlich kompliziert zu sein.
Insgesamt lohnt sich also die Lektüre, besonders für Oberstufenschüler und Studenten, auch weil hier die weltanschauliche Bedingtheit etlicher aktueller Diskussionsthemen deutlich wird. So können wir dem Epilog zustimmen: „In diesem Buch wurde versucht, ‚gute Gründe‘ für die Glaubwürdigkeit der Bibel vorzulegen. Sie können im besten Fall Glaubenshilfe leisten und das Vertrauen in Gottes Wort stärken. Gott und die Wahrheit seines Wortes [zu] beweisen vermögen sie naturgemäß nicht. An Gott zu glauben, ihm und seinem Wort zu vertrauen, das bleibt uns weiterhin aufgetragen. Es ist letztendlich eine existenzielle Entscheidungsfrage, vor der wir stehen und bei der es um buchstäblich ‚alles‘ geht“ (S. 174).
Jochen Klein
[1] Zu Eta Linnemann vgl. ihre Bücher: Was ist glaubwürdig – Die Bibel oder die Bibelkritik? Nürnberg (VTR) 2008. Original oder Fälschung. Historisch-kritische Theologie im Licht der Bibel. Bielefeld (CLV) 2022. Die Bibelkritik auf dem Prüfstand. Wie wissenschaftlich ist „wissenschaftliche Theologie“? Nürnberg (VTR 2013). Wissenschaft oder Meinung? Anfragen und Alternativen. Nürnberg (VTR 2013). Vgl. auch die Kurzzusammenfassung „Das moderne Denken und die Bibelkritik“ auf www.denkendglauben.de.
[2] Vgl. „Kritisches zur postevangelikalen Bewegung“ auf www.denkendglauben.de
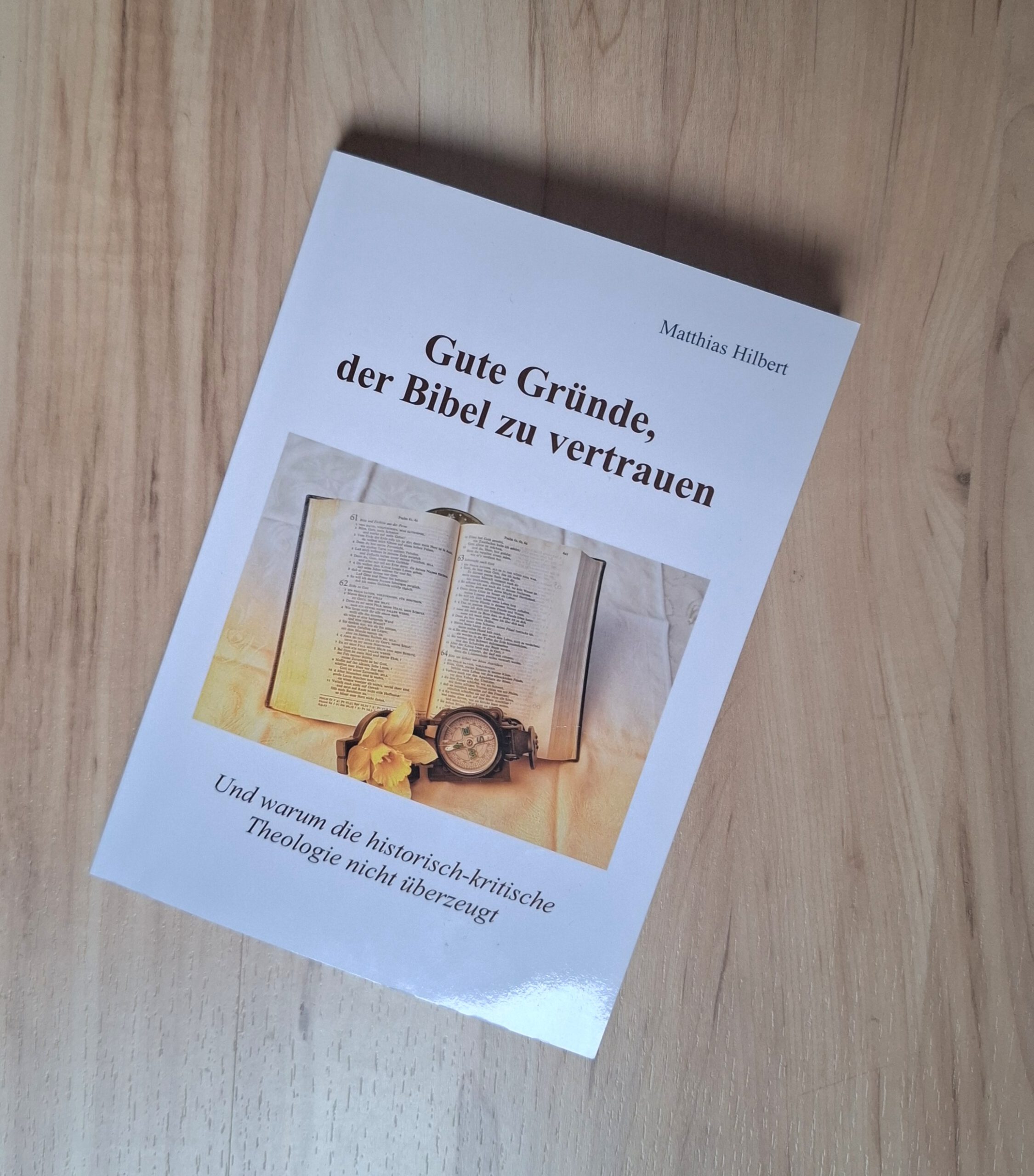
Impressum | Datenschutz
Copyright 2024 © Jochen Klein
Design & Programmierung: Ideegrafik Kreativagentur GmbH